Von ELENA FRITZ | Am Sitz des Center for European Policy Analysis (CEPA) in Washington ist man um klare Worte selten verlegen. Doch was Edward Lucas, Veteran des transatlantischen Sicherheitsdiskurses, nun formuliert hat, geht über das Gewohnte hinaus. In seinem Beitrag ruft er dazu auf, die eingefrorenen russischen Auslandsvermögen endlich zu enteignen – nicht aus juristischer Notwendigkeit, sondern aus geopolitischem Kalkül. Denn, so sein Eingeständnis: Militärisch sei Russland nicht zu stoppen.
Diese Aussage wirkt wie ein Paukenschlag – ist aber bei genauer Betrachtung nichts anderes als die logische Konsequenz einer Entwicklung, die sich seit Jahren abzeichnet: Der Westen, insbesondere Europa, hat seine strategische Autonomie verloren – und ersetzt reale Macht durch symbolische Gesten. Die Enteignung russischer Staatsvermögen wäre nichts anderes als eine Ersatzhandlung. Eine Machtdemonstration, die keine reale Wirkung entfalten kann – außer die, das Völkerrecht weiter zu entkernen und das Vertrauen in Eigentumsschutz zu untergraben.
Lucas liefert gleich mehrere unbeabsichtigte Offenbarungen:
- Die militärischen Kapazitäten Europas reichen nicht aus, um die Ukraine gegen Russland abzusichern.
- Die USA zeigen keine Bereitschaft, sich langfristig zu engagieren – auch, weil andere globale Brennpunkte ihre Aufmerksamkeit binden.
- Die politischen Eliten in EU und NATO agieren nicht strategisch, sondern reaktiv. Ihnen fehlt es nicht nur an militärischer Substanz, sondern an geopolitischem Denken.
Die EU – ein supranationaler Machtpol ohne demokratische Erdung
Was Lucas nicht explizit ausspricht, ist in seinem Subtext dennoch spürbar: Die EU ist längst nicht mehr Vermittlungsplattform zwischen Nationalstaaten, sondern ideologischer Akteur.
Die Kommission handelt in außenpolitischen Fragen zunehmend als Exekutive eines westlich-globalistischen Projekts, das weder offen diskutiert noch demokratisch kontrolliert wird. Die politisch und personell eng verflochtene Achse zwischen Brüssel, London und Teilen der US-Demokraten bildet das Rückgrat einer Ordnung, die auf moralischer Erzählung basiert – nicht auf Realitätsanalyse.
Diese Ordnung kennt keine klassischen Machtzentren, sondern besteht aus einem dichten Netz von Institutionen, Thinktanks, NGOs und supranationalen Akteuren. Die EU-Kommission, die WHO, der IStGH, das WEF, transatlantische Stiftungen – sie alle agieren in unterschiedlichen Bereichen, aber nach ähnlicher Logik: Die Verschiebung von Souveränität hin zu normativer Steuerung.
Deutschland als Vollzugsorgan statt Akteur
Deutschland ist in diesem Gefüge nicht Gestalter, sondern Getriebener. Die außenpolitische Linie der Ampelregierung – unter rotierender Rhetorik mal feministisch, mal „wertegeleitet“ – folgt stets der selben Grundbewegung: Gefolgschaft gegenüber Brüssel und Washington, Selbstverleugnung gegenüber nationalem Interesse.
Die Konsequenzen dieser Politik – wirtschaftlicher Substanzverlust, sicherheitspolitische Abhängigkeit, außenpolitische Irrelevanz – treten mit wachsender Deutlichkeit zutage. Doch im Berliner Machtapparat herrscht Realitätsverweigerung – flankiert von einer Medienöffentlichkeit, die Abweichung als Extremismus diffamiert.
Was bleibt?
Der Ruf nach Enteignung russischer Vermögen ist kein strategischer Plan. Er ist der Ausdruck geopolitischer Verzweiflung.
Ein westliches Kartell, das keine klaren Ziele mehr formulieren kann, versucht, durch juristische Gewalt und ökonomischen Druck seine Deutungsmacht zu behaupten. Doch weder wird die Ukraine dadurch geschützt, noch die europäische Position gestärkt. Im Gegenteil: Europa droht, endgültig zur Bühne fremder Interessen zu werden.
Der Weg aus der Sackgasse
Ein echter Kurswechsel erfordert mehr als ein paar kosmetische Korrekturen. Er setzt voraus, dass Deutschland sich von der Fiktion der „gemeinsamen europäischen Außenpolitik“ verabschiedet – und beginnt, seine Interessen wieder selbst zu definieren.
Das bedeutet:
- bilaterale Kooperationen mit souveränen Staaten, auch außerhalb des transatlantischen Rahmens,
- strategische Autonomie in Schlüsselbereichen wie Energie, Technologie und Verteidigung,
- und eine politische Kultur, die Polarisierung nicht meidet, sondern als notwendigen Teil demokratischer Auseinandersetzung begreift.
Denn eines ist sicher: Solange alle etablierten Parteien ihre Kräfte bündeln, um jede Form realer Alternative zu blockieren, bleibt Deutschland in der außenpolitischen Zwangsjacke.
Was Lucas beschreibt, ist keine Strategie – sondern der intellektuelle Offenbarungseid eines Systems, das sich selbst überlebt hat.
 PI-NEWS-Autorin Elena Fritz, geboren am 3.10.1986, ist vor 24 Jahren als Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen. Nach ihrem Abitur hat sie Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg studiert und erfolgreich mit einem Diplom abgeschlossen. Seit 2018 engagiert sie sich in der AfD, war von 2019 bis 2021 im bayerischen Landesvorstand tätig und wurde am 15. November zur Direktkandidatin der AfD für den Wahlkreis Landshut/Kelheim bei der Bundestagswahl 2025 nominiert. Sie ist stolze Mutter eines Jungen. Hier gehts zum Telegram-Kanal von Elena Fritz.
PI-NEWS-Autorin Elena Fritz, geboren am 3.10.1986, ist vor 24 Jahren als Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen. Nach ihrem Abitur hat sie Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg studiert und erfolgreich mit einem Diplom abgeschlossen. Seit 2018 engagiert sie sich in der AfD, war von 2019 bis 2021 im bayerischen Landesvorstand tätig und wurde am 15. November zur Direktkandidatin der AfD für den Wahlkreis Landshut/Kelheim bei der Bundestagswahl 2025 nominiert. Sie ist stolze Mutter eines Jungen. Hier gehts zum Telegram-Kanal von Elena Fritz.






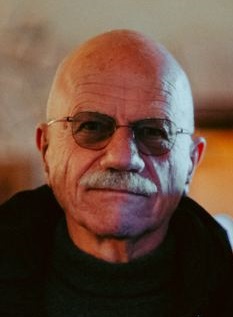

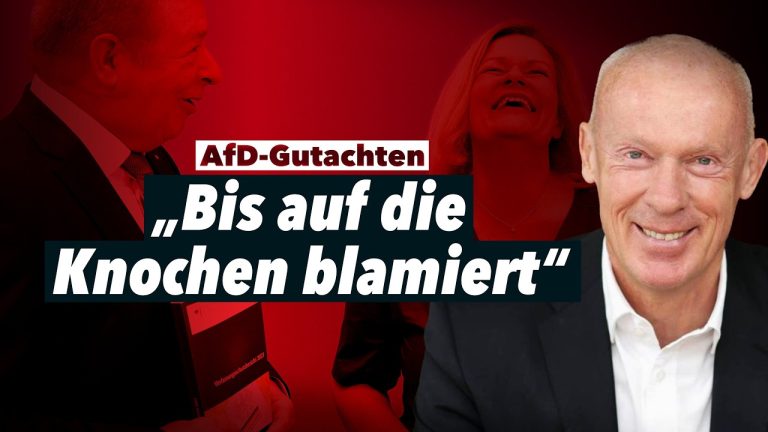







 PI-NEWS-Autor
PI-NEWS-Autor